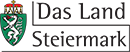Aktuelles Tierseuchen
Maul- und Klauenseuche (MKS)

Seit März 2025 treten vermehrt Fälle der Maul- und Klauenseuche (MKS) in den Nachbarländern Ungarn und der Slowakei auf. Betroffen sind bisher ausschließlich Rinderbetriebe.
In Ungarn wurden Ausbrüche am 7. März, 26. März sowie zwei weitere am 2. April im Komitat Győr-Moson-Sopron gemeldet. In der Slowakei erfolgten Meldungen von drei Ausbrüchen am 21. März, einem vierten am 25. März, einem weiteren im Bratislavský am 30. März, sowie am 4. April im Trnavský.
Aufgrund des grenznahen Ausbruchs in Ungarn am 26. März wurde eine Überwachungszone auf österreichischem Staatsgebiet eingerichtet. Auch der Ausbruch am 30. März in der Slowakei führte zur Ausweisung einer weiteren Überwachungszone in Grenznähe. In beiden Zonen gelten verpflichtende Biosicherheitsmaßnahmen, Handelsbeschränkungen, Jagdverbot sowie ein Verbot von Messen, Märkten und Tierschauen.
Darüber hinaus wurde eine erweiterte Sperrzone in Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands eingerichtet. Dort werden über 1.000 Betriebe mit empfänglichen Tierarten behördlich kontrolliert und stichprobenartig untersucht.
Zum Schutz vor Einschleppung wurden außerdem folgende Maßnahmen gesetzt:
Einfuhrverbot aus den betroffenen Regionen in Ungarn und der Slowakei für lebende empfängliche Tiere, Rohmilch, frisches Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse, Gülle, Mist sowie pflanzliche Einzelfuttermittel. Außerdem erfolgte eine vorübergehende Schließung einzelner Grenzübergänge zu Ungarn und der Slowakei.
Derzeit gibt es keinen Hinweis auf eine Einschleppung der MKS nach Österreich. Dennoch wird das Risiko als hoch eingeschätzt. Die behördlichen Kontrollen und Präventionsmaßnahmen bleiben daher weiterhin intensiviert aufrecht.
Verdachtsfälle sowie das Auftreten von Symptomen wie hohem Fieber bei mehreren Tieren im Bestand oder Aphtenbildung sind unverzüglich der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden, um eine sofortige Abklärung und die Einleitung seuchenhygienischer Maßnahmen zu ermöglichen.
Afrikanische Schweinepest (ASP)

Österreich ist weiterhin frei von der Afrikanischen Schweinepest. In mehreren direkten Nachbarsländern, darunter Ungarn, die Slowakei, Deutschland und Italien, tritt die Seuche jedoch nach wie vor auf.
Im März 2025 wurden in Europa insgesamt 46 Ausbrüche bei Hausschweinen sowie 1.337 Ausbrüche bei Wildschweinen gemeldet. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle ist im Vergleich zu den Vormonaten leicht rückläufig, was in erster Linie auf einen Rückgang der Ausbrüche bei Wildschweinen zurückzuführen ist.
Die meisten Fälle bei Wildschweinen wurden in Polen, Deutschland, Lettland und Litauen registriert. Angesichts der Tatsache, dass der nächste bestätigte Fall der ASP bei Wildschweinen nur 87 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt ist (Slowakei), ist eine konsequente Meldung und virologische Untersuchung tot aufgefundener Wildschweine weiterhin essenziell für die Früherkennung der Tierseuche.
Bei erhöhter Mortalität in Schweinehaltungen sollte zur Abklärung der Ursache zeitnah eine Ausschlussuntersuchung in Erwägung gezogen werden. Bei Verdachtsfall ist in jedem Fall unverzüglich die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu benachrichtigen, um zeitnah weitere Schritte setzten zu können.
Weitere Information zu ASP Situation in Europa findet man unter  KVG und
KVG und  AGES_ASP
AGES_ASP
Blauzungenkrankheit
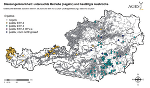
In Österreich treten weiterhin Fälle der Blauzungenkrankheit auf. Seit dem Beginn des Seuchengeschehens im September 2024 wurden vor allem im Westen des Landes Ausbrüche mit dem Serotyp BTV-3 festgestellt, während im Osten überwiegend der Serotyp BTV-4 nachgewiesen wurde. In den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark konnten beide Serotypen identifiziert werden.
Der derzeit definierte vektorfreie Zeitraum ist bis zum 30. April 2025 vorgesehen. Abhängig von den klimatischen Entwicklungen kann es jedoch zu einer Verkürzung oder Verlängerung dieses Zeitraums kommen.
Weitere findet Information zu Situation in Europa findet man unter  AGES_BT und
AGES_BT und  KVG_BT
KVG_BT
Pest der kleinen Wiederkäuer (PPR)
Seit dem erstmaligen Auftreten der Pest der kleinen Wiederkäuer (PPR) im Juli 2024 in Griechenland sowie den darauffolgenden Ausbrüchen in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und zuletzt erneut in Rumänien hat sich das Risiko eines Seucheneintrags nach Österreich erhöht.
Im Rahmen einer stichprobenartigen Quarantäneuntersuchung von Schlachtschafen Ende Februar 2025, wurden in Österreich PPR-positive Tiere festgestellt. Diese wurden tierschutzgerecht getötet, der betroffene Schlachthof umfassend gereinigt und desinfiziert. Nach negativer Untersuchung der umliegenden Betriebe konnte der PPR-freie Status in Österreich aufrechterhalten werden.
Angesichts der aktuellen Seuchensituation hält Österreich an verstärkten veterinärbehördlichen Kontrollen fest und hat vorbeugende Maßnahmen für die Verbringung von Schlachtschafen und-Ziegen aus Griechenland, Bulgarien und Ungarn angeordnet.
Die Verbringung empfänglicher Tiere aus Rumänien in andere EU-Mitgliedstaaten ist gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2025/525 bis mindestens 8. Juni 2025 untersagt.
Weitere findet Information zu Situation in Europa findet man unter  AGES_PPR und
AGES_PPR und  KVG_PPR
KVG_PPR
Schaf- und Ziegenpocken
Das Schafpockenvirus (SPPV) und Ziegenpockenvirus (GTPV) gehören zur Gattung der Capripoxviren. Schaf- und Ziegenpocken sind relativ wirtsspezifisch und kommen in Schafen bzw. Ziegen vor, wobei ausgewählte Stämme in der Lage sind, sowohl Schafe als auch Ziegen zu infizieren. Die Infektion mit dem Virus verläuft überwiegend akut bis subakut. Jungtiere sind meist stärker betroffen sind als ältere Tiere. Sie zeigen oftmals vermehrten Speichelfluss, Nasen- und Augenausfluss, Fieber, Kurzatmigkeit und Appetitlosigkeit. Innerhalb weniger Tage treten knotenartige Hautläsionen und ulzerierende Papeln an wenig behaarten Körperstellen auf. Diese trocknen später ab und bilden Krusten. Viren lassen sich im Augen- und Nasensekret, im Speichel und vor allem in den Hautläsionen nachweisen. Sie finden sich auch im Blut, im Harn, im Kot, im Samen und in der Milch. Eine direkte Übertragung von Tier zu Tier erfolgt über ulzerös zerfallende Papeln, Aerosole und Tröpfcheninfektionen. Aufgrund der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Viren in der Umwelt ist auch die indirekte Übertragung über Wolle, Haare, Gerätschaften und unzureichend behandelte Tierhäute von Bedeutung. Der Mensch kann sich nach aktuellem Wissensstand nicht infizieren.
Ausbrüche der Krankheit sind in den letzten Monaten in Bulgarien, Griechenland und Türkei gemeldet worden. Insgesamt gab es im März 13 Ausbrüche von Schaf -und Ziegenpocken in Griechenland und Türkei. In Österreich wird das Risiko derzeit als gering eingestuft.
Es sind Impfstoffe für verschiedene Stämme vorhanden, welche jedoch in der EU nicht zugelassen sind. Impfungen innerhalb der EU sind entsprechend der Delegierte Verordnung (EU) 2023/361 grundsätzlich möglich. Bei einem Verdacht auf Einschleppung des Erregers können jederzeit Proben von verdächtigen Tieren an die AGES Mödling geschickt werden.
Weitere Information zu Situation in findet man auf der  KVG_SchafundZiegenpocken
KVG_SchafundZiegenpocken
Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI)
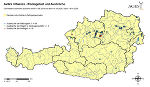
Nach mehreren Ausbrüchen der hochpathogenen aviären Influenza vom Subtyp H5N1 bei Wildvögeln, in Geflügelhaltungen sowie in Hobbybeständen hat sich die Seuchenlage in den vergangenen Wochen etwas entspannt. Der letzte Nachweis erfolgte am 8.April bei einem Storch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.
Mit März 2025 wurde per Kundmachung das gesamte Bundesgebiet als Gebiet mit erhöhtem Risiko ausgewiesen. Zonen mit stark erhöhtem Risiko bestehen aktuell nicht mehr. Das aktuelle Risiko für Österreich wird als mittel bewertet.
Im Gegensatz dazu hat sich die Zahl der Ausbrüche beim Nutzgeflügel in Europa im März mehr als verdoppelt, insbesondere aufgrund gehäufter Meldungen aus Ungarn und Polen. Die Zahl der Nachweise bei Wildvögeln ist hingegen rückläufig.
GeflügelhalterInnen sind weiterhin angehalten, auf konsequente Biosicherheitsmaßnahmen zu achten. Jeglicher direkte und indirekte Kontakt zwischen Nutzgeflügel und Wildvögel ist nach wie vor zu vermeiden. Außerdem ist jede Geflügelhaltung bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden.
Weitere Information zu Situation in Österreich findet man auf der  AGES_AI und
AGES_AI und  KVG_AI
KVG_AI
Newcastle Disease (NCD)
Im Februar 2025 wurde ein Ausbruch der Newcastle Disease (NCD) in einem Freiland-Legehennen Betrieb in Slowenien gemeldet, ca. 8 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt. In Folge wurden eine Schutz- sowie eine Überwachungszone eingerichtet. Letztere erstreckte sich bis in die Steiermark, diese konnte jedoch mit 20. März 2025 wieder aufgehoben werden.
Der Erreger der Newcastle Disease ist das Newcastle Disease Virus (Avian Avulavirus 1, APMV-1), ein Einzelstrang-RNA-Virus aus der Familie der Paramyxoviridae. Newcastle Disease ist eine anzeigepflichtige Krankheit. Gemäß AHL (Europäisches Tiergesundheitsrecht) gehört sie zu den Tierseuchen der Kategorie A (sie ist mit allen Mitteln zu bekämpfen). Nur hochpathogene Virustypen werden als Seuche angezeigt, wenn mittels Sequenzierung des viralen Fusionprotein-Gens ein velogener (hochpathogener) Pathotyp des Virusstammes festgestellt wird oder das Virus einen Pathogenitätsindex (ICPI) von 0,7 oder höher aufweist.
Symptome der Newcastle Disease können sein: Schnupfen, neurologische Symptome, Durchfall. Das Krankheitsbild erinnert an die Aviäre Influenza (Geflügelpest, Vogelgrippe).
In Knochenmark und Muskulatur von Schlachtgeflügel bleibt das NCD-Virus bei -20 ⁰C 6 Monate, bei 1 ⁰C bis zu 134 Tage infektiös. In verseuchten Ställen bleibt das Virus je nach Umgebungstemperatur 25-30 Tage infektiös. Durch Eintrocknung kann die Infektiosität des Virus über Jahre konserviert bleiben.
Die Übertragung kann über die Luft, direkt oder über Gegenstände erfolgen. NDV wird in großen Mengen über Kot, Augen-, Nasen- und Rachensekrete und alle weiteren Körperflüssigkeiten ausgeschieden. Die Virusausscheidung beginnt während der Inkubationszeit und kann, abhängig von der betroffenen Vogelspezies, 1-2 Wochen bis zu mehreren Monaten oder etwa 1 Jahr dauern; bei geimpften Tieren etwa 2 Wochen.
Eine prophylaktische Impfung ist in Österreich erlaubt. Es gibt derzeit keine Therapie. Aktuell werden attenuierte Lebendimpfstoffe (lentogen) verwendet und ab dem 1. Lebenstag eingesetzt. Für Booster-Impfungen können auch inaktivierte Impfstoffe verwendet werden. Der Impfstoff kann per (Grob-) Spray-, oculo-nasaler Instillation, über das Trinkwasser oder Injektion verabreicht werden. Impfzeitpunkt und Applikationsform sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten (wie Immunstatus, Infektionsdruck, Haltungsform und Aufzuchtprogramm) festzulegen. Bitte beachten Sie die Impfempfehlung der Hersteller.
Weitere Information zu Situation in Österreich findet man auf der  AGES_NCD
AGES_NCD